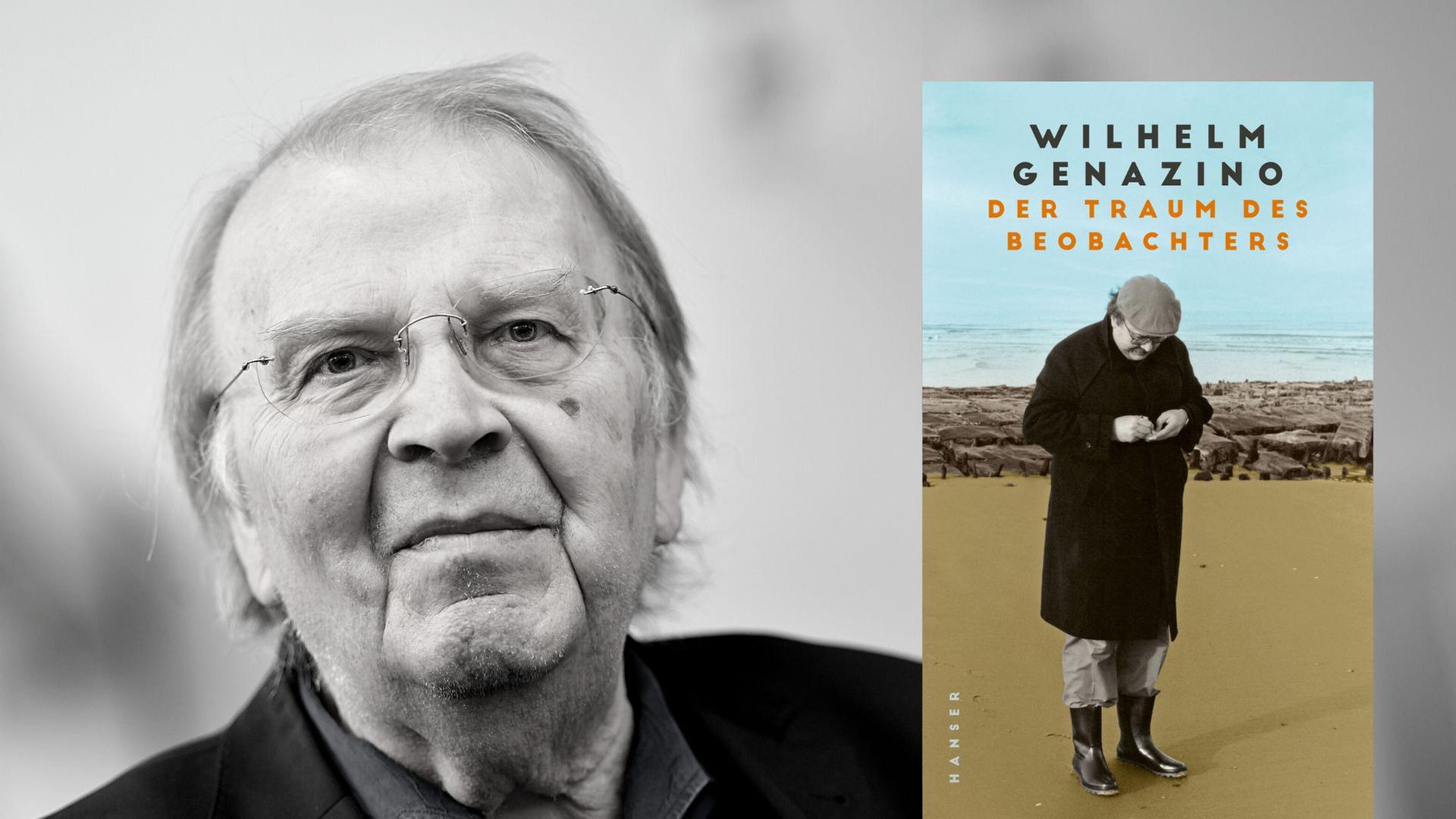
Mit einem Brief vom 18. September 1981 tut sich für Wilhelm Genazino eine interessante neue Einnahmequelle auf: als „Schuh-Tester“ nämlich. Der knapp 40-jährige Autor, gerade war sein Roman „Die Ausschweifung“ erschienen, hatte sich auf eine Zeitungsanzeige hin bei der Firma Bata Schuhe GmbH gemeldet. Im Antwortschreiben des Unternehmens wird genauestens erläutert, was der Bewerber zu leisten habe: Nach einem vorgegebenen Fragenkatalog soll die Kollektion „SOFTIE 2000“ „realistisch“ getestet werden.
„Wir stellen uns vor, daß Sie drei Wochen ein paar Schuhe tragen, nein sogar strapazieren, und uns ihr Ergebnis in den Fragebogen eintragen. Nach Ablauf der Testzeit übergeben Sie uns den Bogen zur Auswertung.“
100 DM lässt sich Bata den Dienst am Kunden kosten, dazu wird noch eine „Schuh-Tester-Urkunde“ in Aussicht gestellt.
„Ist das nicht auch für Sie eine reizvolle Sache? Keine Angst, wir verlangen nichts Meilenweites.“
Vom Geheimtipp zum Bestellerautor
Aus der Sache ist am Ende doch nichts geworden, zumindest scheint Genazino seinerzeit die Nebenbeschäftigung im wahrsten Sinne des Wortes nicht angetreten zu haben. Folgen hatte die Bewerbung aber doch: Im August 1995 notiert er die Idee für einen Roman.
„Ablehnungsbrief kommt von Schuhfabrik (eventuell teilen: er liest Anzeige: Schuhtester gesucht). Er hatte sich das schön vorgestellt. Umhergehend Geld zu verdienen, vielleicht kleine Berichte über Schuhe schreiben und dabei Urteile fällen.“
Im Jahr 2001 – 20 Jahre nach dem Briefwechsel mit Bata und sechs Jahre nach der ersten Idee – erscheint Wilhelm Genazinos „Ein Regenschirm für diesen Tag“, dessen Hauptfigur als Schuhtester reüssiert.
Von der überraschenden Genese dieses Buchs, das seinen Autor über Nacht vom gut gehüteten Geheimtipp zum Bestsellerautor beförderte, erfahren wir aus einer bemerkenswerten Neuerscheinung: „Der Traum des Beobachters“ versammelt Aufzeichnungen Wilhelm Genazinos, die im Jahr 1972 einsetzen und in seinem Todesjahr 2018 enden. Es ist eine riesige Sammlung von meist wenige Zeilen langen Notaten, die zum „Materialcontainer“ seiner Romane und Essays wurde. In einem Interview aus dem Jahr 2014 erzählte er von diesen Skizzen.
"Die habe ich über 30 Jahre oder so angefertigt. Das ist eben meine Arbeitsmethode, das mache ich bis heute. Also, wenn ich irgendeinen Einfall habe oder eine Entdeckung mache oder eine Beobachtung, dann tippe ich die aus der Lamäng heraus auf ein Blatt Papier, und die kriegen eine laufende Nummer und werden nach wie vor in Ordner eingeklemmt und aufbewahrt. Und häufig ist es so, dass, wenn ich ein Buch schreibe, dass ich dann also in diesen Mappen blättere, weil ich irgendwie mich erinnere, ich hab doch mal dazu und dazu irgendwas geschrieben und das möchte ich dann doch mal wiederlesen, (…) und ich merke, vieles ist davon doch für den aktuellen Fall brauchbar."
Der Nachlass in Marbach
Gut 40 Leitzordner und 7000 Seiten hat Genazino im Laufe der Jahre mit seinen Aufzeichnungen gefüllt: Auf Spaziergängen durch Frankfurt und andere Städte hatte er stets Zettelchen dabei, die er sich in seine Brusttasche steckte und auf denen er noch auf der Straße Eindrücke notierte. Im Anschluss übertrug er sie per Schreibmaschine auf ein DIN-A-4-Blatt; meist überarbeitete oder verwandelte er die flüchtigen Notizen da bereits und versah sie mit Datum und Nummer. Dieses riesige Konvolut bildet das Herzstück von Genazinos Nachlass. Der liegt – verstaut in etlichen grünen Kästen – im Deutschen Literaturarchiv, dem „unterirdischen Himmel“, wie Martin Walser die Katakomben der Marbacher Schillerhöhe einmal nannte. Genazino findet sich dort in guter Gesellschaft: zwischen Hans Georg Gadamer und Robert Gernhardt. Bei dem einen hörte er in den 80er-Jahren bei seinem nachgeholten Philosophiestudium Vorlesungen; mit dem anderen war er nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern er arbeitete in den 70er-Jahren auch zusammen mit Gernhardt bei der legendären Frankfurter Satire-Zeitschrift "Pardon".
Schon mit Anfang 20 hatte Genazino Mitte der 60er-Jahre seinen ersten Roman „Laslinstraße“ herausgebracht. Es folgte eine längere Veröffentlichungs-Pause bis Mitte der 70er-Jahre. In der Zwischenzeit begann er mit seinen Notizen.
"Das Werktagebuch, ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob er selbst so genannt hat. Aber ich habe neulich mal eine Stelle gefunden, wo er mal eine Kleinigkeit drüber geschrieben hat. Und da hat er es auch mal so genannt. (…) die standen in der Wohnung mit Kürzeln, ein Kürzel ist EP, ein anderes ist A. D gibt es auch noch."
Der Literaturwissenschaftler und Archivar Jan Bürger betreut in Marbach den Nachlass Genazinos.
"Kürzeln, von denen er mir immer gesagt hat, er wisse gar nicht, was die eigentlich bedeuten, ob die irgendwas bedeuten. Ich glaube, EP heißt wahrscheinlich am Anfang, als er damit loslegte, Einfälle Prosa. Und bei D bin ich mir ziemlich sicher, dass es Dramatisches ist. Oder Drama, weil da einfach Entwürfe für dialogische Texte darin sind, bei A und B, keine Ahnung. Es kann alles heißen."
Jan Bürger hat zusammen mit dem Literaturwissenschaftler Friedhelm Marx diese überbordende Materialsammlung durchforstet – und eine Auswahl getroffen, die nun in dem Band „Der Traum des Beobachters“ auf gut 450 Seiten die Ursprungsideen, Glutkerne, Motive von Genazinos Werk vom Hintergrund ins Zentrum rückt.
"Es wird immer systematischer. Also hier hat er zum Beispiel mal, da sieht man, dann hat er 1973, da macht er immer noch kleine Abstandhalter dazwischen. Da notiert er einfach durcheinander Sachen für ein Stück, dann auch so, schon diese Melancholie-Erfahrung, das ist ein großes Thema, „das Gefühl, wenn man ein einzelnes Haar im Mund hat und es sich herauszieht. Man kann nicht näher angeben, wo es sich befindet, nur irgendwo im Mund. Offenbar kann man nicht fühlen, wo bei der Zunge vorn und hinten ist.“ Das ist gar nicht mal so melancholisch, es gibt dann auch so eine Stelle da noch, „mir ist, als würden mir die Lippen abbrennen“. (…) Dann merkt man, da geht es dann schon voll hinein. Aber es wird dann im Laufe des der ersten Jahre immer weniger normales Tagebuch und immer mehr Arbeitsinstrument."
Scheitern und drohendes Unglück
Dass Genazino dieses höchst spielerische und zugleich bürokratisch wohlgeordnete Aufzeichnungsverfahren gewählt hat, dürfte verschiedene Gründe haben: Nach seinen Ausflügen in die Realität, seinen Spaziergängen durch die ihn mit Schreibreizen beliefernde Stadt, musste er seine Eindrücke rasch notieren und wiederauffindbar archivieren. Er liest die Gegenwart auf der Straße auf und erschafft sich ein System von Erinnerungen. Genazinos Literatur lebt gerade von jenen umherschweifenden Beobachtungen, die sich zu kleinen, manchmal traumhaften Sequenzen verdichten oder in luzide Reflexionen übergehen – die Notatsammlung wurde so zum Steinbruch für die Romane und Essays. Zudem führte das tagtägliche Protokollieren von Merkenswertem zu einer notwendigen Schreibroutine.
„Prosa muß man mit System schreiben, das heißt: regelmäßig. Der Vorteil der Regelmäßigkeit liegt darin, daß man in den Vorteil jeder vernünftigen Tätigkeit kommt, und diese Vernunft besteht darin, daß man seine Arbeit wiedererkennt.“
Auf das Gesammelte und per „Codierungssystem“ Verwertbare griff er dann bei verschiedensten Projekten zurück. Er selbst nannte das Werktagebuch eine „Prothese des Schreibens“. Mit diesem Verfahren – einem dreistufigen Prozess des Betrachtens, Skizzierens, Ausformulierens – konnte er auch einer ihn lebenslang begleitenden Sorge begegnen:
„Die Angst, daß mich eines Tages das Schreiben selbst verlassen würde. Dann würde ich nur noch zu Hause sitzen, ratlos, berufslos, ohne Geld, bald ohne Wohnung und bald auch ohne einen einzigen Menschen, der es mit meiner Verlassenheit aufnehmen würde.“
Das Werktagebuch war also nicht nur ein Hilfsmittel, sondern auch ein Antidot gegen das mangelnde Vertrauen in eine endlos sprudelnde Kreativität. So verwundert es nicht, dass das Thema des Scheiterns, der Erfolglosigkeit, des drohenden Unglücks immer wieder in seinen Aufzeichnungen auftaucht, schon gleich zu Beginn im Jahr 1972.
„Ich habe kein Konzept für mein Leben. Ich komme mir oft vor wie der einzige Unglückliche unter lauter Glücklichen; das ist natürlich eine der Übertreibungen, die das negative Denken liebt, wenn es erst einmal in Gang gesetzt ist; man möchte ja auf das Glück kommen. Aber in der Umwelt sehen wir fast nur die Dynamik des Unglücks, und wer sich intellektuell halbwegs ernst nimmt, muß diese Dynamik wahrnehmen.“
Der Hose beim Verrotten zusehen
Die beiden Herausgeber Jan Bürger und Friedhelm Marx unterscheiden in ihrer Auswahl nicht zwischen jenen Sätzen, die Wilhelm Genazino mit einem „v“ für „verwendet“ versehen hat, und solchen, die später nicht oder in verwandelter Form Eingang gefunden haben in die veröffentlichten Bücher. Das hat durchaus Berechtigung. Denn auch jene Passagen, die Genazino in seine Romane einbaut, erfahren noch einmal eine oder mehrere Transformationen. Es bleibt dem Leser überlassen, solche Verwandlungen und Verwendungen zu erkennen. So macht Genazino sich in den späten 70er-Jahren immer wieder Gedanken zu einem „Bordellroman“, der vermutlich nie entstanden ist. Etliche Fragmente daraus sind im Werktagebuch nun nachzulesen, und manche davon dienten ihm später als Bruchstücke für andere Romane. Auch eine Notiz wie diese aus dem Jahr 1983 dürfte Genazino-Lesern bekannt vorkommen, ja, sie hat geradezu etwas Leitmotivisches:
„Eine alte Hose, deren Stoff an einigen Stellen ganz dünn geworden ist; er zog die Hose in der Phase ihrer Auflösung jeden Tag an, weil er sehen wollte, wie und wo sich die dünnen Stellen zu Löchern weiteten.“
Fadenscheinig gewordene Kleidungsstücke finden sich immer wieder in Genazinos Romanen; sie werden bei ihm zu Stellvertretern oder Symbolen für die Verfallsdynamiken, denen sich die Protagonisten ausgesetzt sehen. In „Das Glück in glücksfernen Zeiten“ von 2009 hängt der Erzähler seine Hose irgendwann auf den Balkon, um ihr beim allmählichen Verrotten zuzusehen. Durch den Kleiderzerfall, heißt es da, werde jedermann mit seiner Selbstauflösung vertraut. Ein paar Tage später, im Dezember 1983, wird im Werktagebuch ein Titel für ein zukünftiges Buch erwähnt:
„Die Hose, das Loch, die Kunst, der Mantel, der Fleck“
Zwei Monate danach, unter dem Datum vom 23. Februar 1984, lesen wir folgendes:
„Beim Betrachten tropfte ihm ein wenig Kaffeesahne auf den dunklen Mantel, Er betrachtete den Fleck und entfernte ihn nicht. Der Fleck betonte die Ungültigkeit alles dessen, was sich gerade ereignete.“
Sechs Jahre später, 1989, erscheint der Roman „Der Fleck, die Zimmer, die Jacke, der Schmerz“, der eine Wende im Genazinoschen Oeuvre darstellt – hin zu einem fragmentarischeren Erzählen, zu jener für Genazino typischen, episodenhaften Verdichtung der „Gesamtmerkwürdigkeit des Lebens“, einem leichten Schweben zwischen Melancholie und Komik. Mit dem Fleck-Buch scheint er erstmals einem Ideal nahezukommen, das er sich bereits am 8. November 1983 auf die Fahne und ins Werktagebuch schreibt:
„Schriftsteller, die genau beobachten, brauchen nicht erfinden. Die genaue Wahrnehmung ist die Erfindung.“
So kann man anhand seiner Aufzeichnungen sehr genau die ästhetischen Such- und Denkbewegungen Genazinos nachvollziehen, den Entstehungsprozessen einzelner Bücher folgen. Nur selten schimmern offensichtlich biografische Ereignisse durch die Zeilen. Diese liefern Jan Bürger und Friedhelm Marx dankenswerterweise in kurzen Einführungsvignetten zu den einzelnen Jahren: Daraus entsteht eine zwar grob gezeichnete, aber aufschlussreiche Lebensskizze. Man erfährt von den Brotjobs Genazinos bei Zeitungen; von Wohnortwechseln; seinen Partnerschaften, von seinem erfolgreichen Vorhaben, in fortgeschrittenem Alter, Abitur und Studium nachzuholen; von den Büchern, an denen er jeweils arbeitete; den Würdigungen, die ihm vor allem nach 1990 zuteil wurden – und deren wichtigste der Büchner-Preis im Jahr 2004 war.
Das Werktagebuch als Spielwiese
Dass „Der Traum des Beobachters“ aber so faszinierend und augenweitend ist, liegt daran, dass das Buch auch ohne literaturhistorische Rückbindung an das Hauptwerk – die Romane und Essays – mit größtem Gewinn und Vergnügen zu lesen ist. Kleine Szenen und Beobachtungen können ganz für sich stehen:
„Schild an einer Hauswand: Liegendanfahrt. Das Wort beschäftigt mich sofort, ich finde es schön, daß man liegend irgendwo hingefahren wird. Dann sehe ich, es handelt sich um den Hinterhauseingang einer Klinik. Natürlich! Die Menschen machen nur das Allernötigste. Warum gibt es keine Liegendanfahrt zum Büro oder zum Bahnhof? Die Menschen werden nur dann liegend gefahren, wenn sie verletzt oder schon halbtot sind.“
Genazino glänzt auch als Aphoristiker:
„Der Künstler ist vielleicht der einzige, der der laufenden Selbstenthüllung des Lebens gewachsen ist.“
Und als Gesellschaftskritiker mit Weitsicht:
„In zehn oder fünfzehn Jahren wird es Fernsehsendungen geben, deren Dummheit wie eine körperliche Verletzung wirken wird. 21. März 1985“
Es finden sich eingeklebte Fotos, Zeitungsausrisse, Fundstücke, aber auch ein paar Briefe, die mit Genazinos aktueller Arbeit verknüpft waren – wie etwa ein Schreiben an Brigitte Kronauer:
„Dieses gemächliche Hervorrücken und Vorwärtsschieben von etwas (von Erfahrung, Wahrnehmung) könnte man Ihre »unerhörte Allmählichkeit« nennen (so bezeichne ich jedenfalls Ihre Schreibweise in dem Rundfunkessay über Sie, den ich zur Zeit schreibe). Oder finden Sie[,] das[s] das an Ihnen vorbeigeht?“
Die Auseinandersetzung mit Brigitte Kronauers Werk deutet es schon an – Überlegungen zu Autorinnen und Autoren, meist in Hinblick auf entstehende Essays gesammelt, tauchen immer wieder auf. An Samuel Beckett, Virginia Woolf und Heinrich von Kleist versucht der Autor Genazino das eigene Schreiben oder poetologische Denken zu schärfen, Franz Kafka spielt eine gewichtige Rolle, Gottfried Keller und Theodor Fontane sind präsent. Und auch an einem Frankfurter Kollegen arbeitet er sich ab:
„Goethe mußte ein durchdringendes Gefühl davon gehabt haben, welch ein Erzversager er gegenüber Hölderlin werden könnte oder vielleicht schon war. Und rings um ihn durfte sich nichts mehr rühren, damit sein Versagen verschleiert bleiben konnte.“
Das Werktagebuch ist eine Spielwiese. Auf ihr kann Genazino sich frei und noch ohne Ziel austoben, epiphanische Erfahrungen notieren, ohne sie in einen Kontext stellen zu müssen. Er schreibt hier nicht auf etwas Konkretes hin, aber doch führen seine Aufzeichnungen immer zu etwas, das zunächst noch wenig konturiert ist oder sich erst im Laufe der Zeit zu einem Thema oder Roman ordnet. Jan Bürger und Friedhelm Marx nennen die Arbeitsmitschriften „eine einzigartige Chronik der Welt- und Selbstwahrnehmungen eines versierten, chronisch überempfindlichen Schriftstellers“. Die Idiosynkrasien Genazinos, die Gefühle von Scham und Verlustangst sind immer wieder deutlich zu erkennen. Ebenso natürlich wie der Genazinosche Stil, der seine Prägnanz einer vermeintlich einfachen Sprache verdankt, deren Abgründigkeit durch eine lakonisch anmutende Komik erträglich gemacht wird. „Leidfreie Zwiespältigkeit“ nennt Genazino dieses komische Moment, das keinesfalls mit dem humoristischen Gestus einiger seiner Freunde aus der Neuen Frankfurter Schule verwechselt werden darf.
„Wenn man nicht jung gewesen wäre, würde man im Alter nicht sonderbar aussehen. Aber weil man einmal jung war, kennt man sein Gesicht ohne die Ausschreitungen des Alters.“
Kunstvolle Trostangebote
Die Ausschreitung des Alters – die Werktagebücher legen auch davon Zeugnis ab. Wer Genazinos Romane kennt, weiß: Deren Stimmung wird spätestens in den 2010er-Jahren finsterer; die Verlorenheit und Einsamkeit seiner Helden werden kaum noch kaschiert. Freilich gilt das auch für die Notate, die diesen Romanen zugrunde liegen. Aus der Melancholie weist die Komik kaum noch einen Weg. Nach und nach trübt die Düsternis all das ein, was einmal poetischen Zauber zu entfalten in der Lage war. Oder anders gesagt: Der literarische Zauber ist am Ende ganz seines Glitters entledigt, es steht nur noch etwas Rohes da, eine unverhüllte poetische Wehmut. Es sind zuweilen Sätze, die sich allen kunstvollen Trostangeboten verweigern.
„Bald bin ich übrigens tot 1. September 2008“
Es sollten noch zehn Jahre bis zu Genazinos Tod vergehen. Am 12. Dezember 2018 starb der Büchner-Preisträger in Frankfurt am Main, dem Ort, der für seine Bücher eine wesentliche Bedeutung gewann, gerade weil er den Charakter einer austauschbaren Großstadt hat. Am 22. Januar 2023 wäre Genazino 80 Jahre alt geworden. Was von ihm bleibt? Einige seiner Romane, die hochreflektierten Essays über den gedehnten Blick, zur Fotografie, zur Komik. Nicht zuletzt aber seine bedeutenden Werktagebücher, die das einzulösen scheinen, was Genazino am 20. November 1981 folgendermaßen formulierte:
„Gelebt wird nicht während des Lebens; gelebt wird bei der nachträglichen Erzählung von Leben.“
Wilhelm Genazino: "Der Traum des Beobachters. Aufzeichnungen 1972 - 2018"
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Jan Bürger und Friedhelm Marx
Hanser Verlag, München, 464 Seiten, 34 Euro.
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Jan Bürger und Friedhelm Marx
Hanser Verlag, München, 464 Seiten, 34 Euro.
