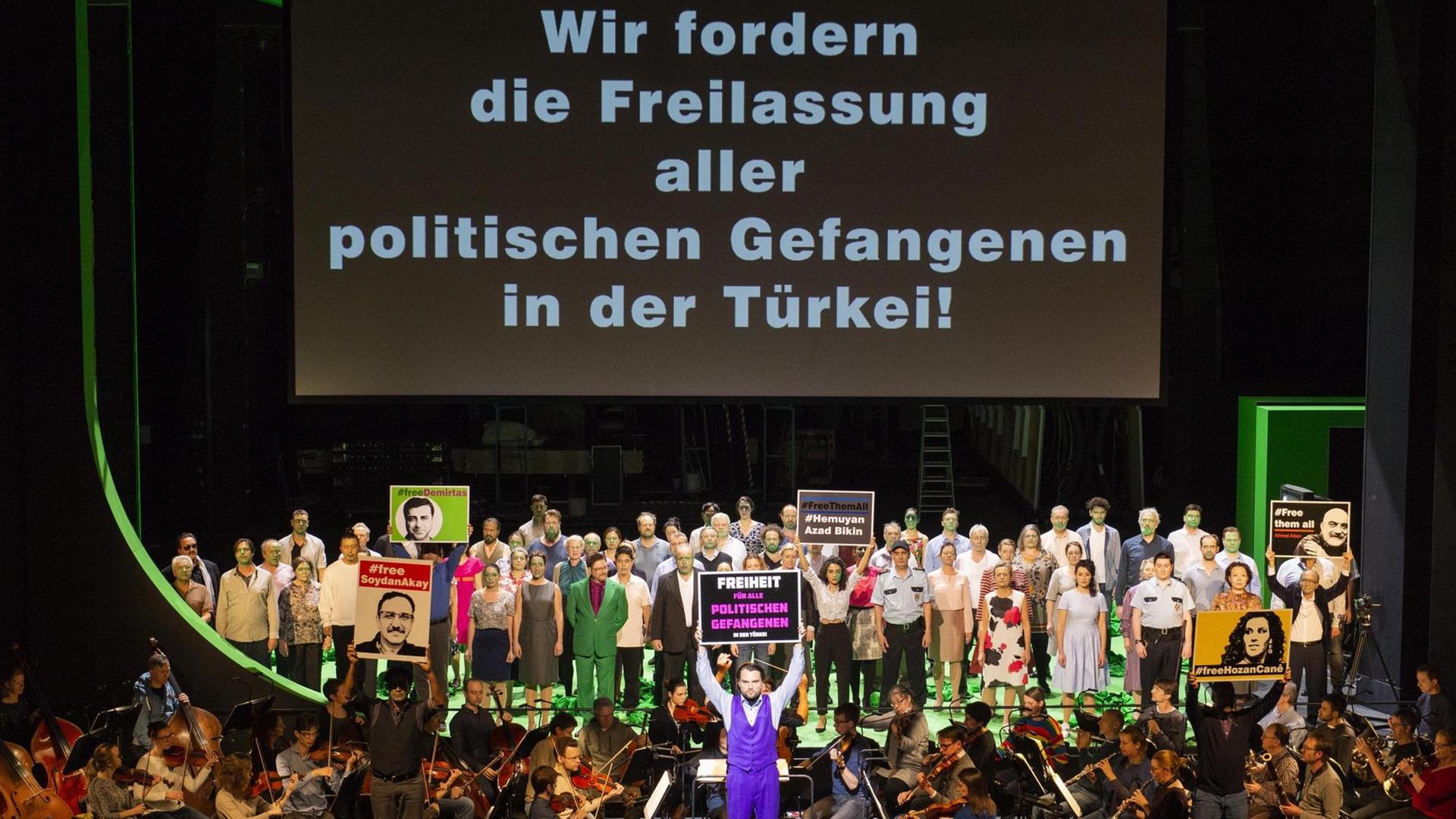Vieles tönt ungewohnt an diesem frühen "Fidelio". Denn er ist kammermusikalisch luzider instrumentiert als die Endfassung der einzigen Oper Beethovens von 1814. Einiges ist nahezu unbekannt, wie dieses delikate Duett zwischen Leonore und Marzelline, das den straffenden Strichen der späteren "Fidelio"-Versionen zum Opfer fiel. Faszinierend, wie solistische Streicher im Orchestergraben diesen Dialog "Um in der Ehe froh zu leben" gleichsam kommentieren. Was die Urfassung von 1805 insgesamt so bezwingend macht, ist ihre musikalische Dramaturgie: Anders als in der dritten Version des "Fidelio" ist nämlich kein großer Bruch hörbar. Auch im finalen Akt der ursprünglich dreiaktigen Oper dominiert ein leichter Tonfall, der an Singspiele Haydns erinnert, manchmal sogar an Opere buffe von Mozart.
Selbst dunkle Passagen, wie die Kerkerszene mit Leonore und Rocco, kommen mit einem leichten Brio daher. Auch Florestans große Auftrittsarie, "Gott! Welch Dunkel hier!", ist bei weitem nicht so heldisch und in so hohen Registern angelegt wie in der Fassung von 1814. Und die beiden wuchtigen Finale fügte Beethoven erst in die zweiaktige Endfassung ein – eine musikalische Reaktion auf den durch Georg Friedrich Treitschke sozio-politisch geschärften Text.
Klangfarbenreich spielendes Orchester der Wiener Staatsoper
Das transparente und klangfarbenreich spielende Orchester der Wiener Staatsoper setzte unter der Leitung von Tomáš Netopil eigentlich ein perfektes orchestrales Fundament für ein würdiges Beethoven-Fest. Doch leider stand dem die äußerst durchschnittliche Sängerbesetzung entgegen.
Chen Reiss als Marzelline und Jörg Schneider als Jaquino bilden ein wenigstens solides Buffo-Paar; Falk Struckmann singt einen rauen Rocco, aber immerhin von kräftiger Statur. Was Thomas Johannes Mayer, der als Pizarro oft kaum hörbar ist, leider gänzlich vermissen lässt. Als treibende Kraft einer Intrige lässt sich diese blasse Figur nicht identifizieren.
Stimmlich stärker, aber rhythmisch und intonationstechnisch extrem unsicher ist die junge irische Sopranistin Jennifer Davis als Leonore, die auch mit ihrem artikulatorisch unklaren Deutsch zu kämpfen hat. So bleibt als vokaler Lichtblick – neben dem gut vorbereiteten Staatsopernchor – nur Benjamin Bruns als Florestan. Dessen lyrischer Tenor passt bestens zum leichten Duktus der Urfassung.
Vokale Probleme bei der Staatsopern-Premiere
Ein Unglück kommt selten allein. Und so gesellte sich zu den vokalen Problemen dieser Staatsopern-Premiere auch ein szenisches. Fragwürdig ist schon das Bühnenbild von Alexander Müller-Elmau, das aussieht wie eine abgetakelte Bahnhofshalle der 1950er-Jahre. In diesem Einheitsbild zeigt Regisseurin Amélie Niermeyer zunächst ein rastloses Treiben: Sicherheitspersonal riegelt Teile der Halle ab; Menschen drängeln sich an einem Schalter, um Fahrkarten zu kaufen; Obdachlose umringen den kleinen Buffetwagen, den Marzelline durch die Halle schiebt, um die Hungrigen zu verköstigen. Das alles wirkt zwar ziemlich rätselhaft, doch im Vergleich zur klaustrophobischen Enge eines Gefängnisses auch reichlich harmlos.
Das wiegt umso schwerer, weil zur 2. Leonoren-Ouvertüre, mit der die "Fidelio"-Urfassung beginnt, eine beklemmende Szene gezeigt wird: Das lustvolle Turteln Leonores und Florestans in einem spießigen Blümchentapeten-Zimmer wird jäh unterbrochen, als Florestan ins Nebenzimmer verschwindet – und nicht mehr wiederkehrt. Auf der Suche nach ihrem Mann findet Leonore nur noch ein blutiges Hemd: Entsetzt wird ihr klar, dass Florestan entführt oder gar ermordet wurde. Von solch einer bedrohlich-totalitären Atmosphäre ist in der weit offenen Bahnhofshalle jedoch kaum etwas zu spüren.
Nicht alle Regie-Ideen überzeugen
Auch die zweite grundlegende Regie-Idee Niermeyers überzeugt nicht. Um Beethovens Oper an unsere Gegenwart heranzurücken, wurden nämlich die originalen Dialoge Joseph von Sonnleitners gestrichen und durch Texte des Theaterautors Moritz Rinke ersetzt. Mit Hilfe einer zweiten, auch szenisch präsenten Leonore führt die Protagonistin innere Zwiegespräche.
Nur selten sind die Dialoge zwischen den beiden Leonoren, der Sängerin Jennifer Davis und der Schauspielerin Katrin Röver, inhaltlich so konkret wie an dieser Stelle, an der die Intrige Pizarros zumindest angedeutet wird. Ansonsten bestimmen die einander widerstreitenden Gefühle Leonores diese Innenschau. Dadurch konzentriert sich die Inszenierung ganz aufs Individuelle, Private, ohne daraus Erkenntnisgewinn zu schlagen. Im Gegenteil, die politischen Umstände eines fragwürdig-totalitären Staates werden dadurch in den Hintergrund gedrängt.
Widersprüchlich ist auch das Finale, das die sterbende Leonore als Vision erlebt. Von Pizarro soeben niedergestochen, sieht die tödlich Verwundete ihr Double als heiles Wesen mit Florestan vereint, inmitten einer glitzerrevueartig kostümierten Gesellschaft. Als Utopie einer glücklichen Zukunft taugt diese Spaßgesellschaft wohl kaum, und für eine Karikatur ist das viel zu wenig bissig. Weshalb das enttäuschte Wiener Publikum Niermeyer und ihr Team mit einem wahren Buh-Orkan bedachte.